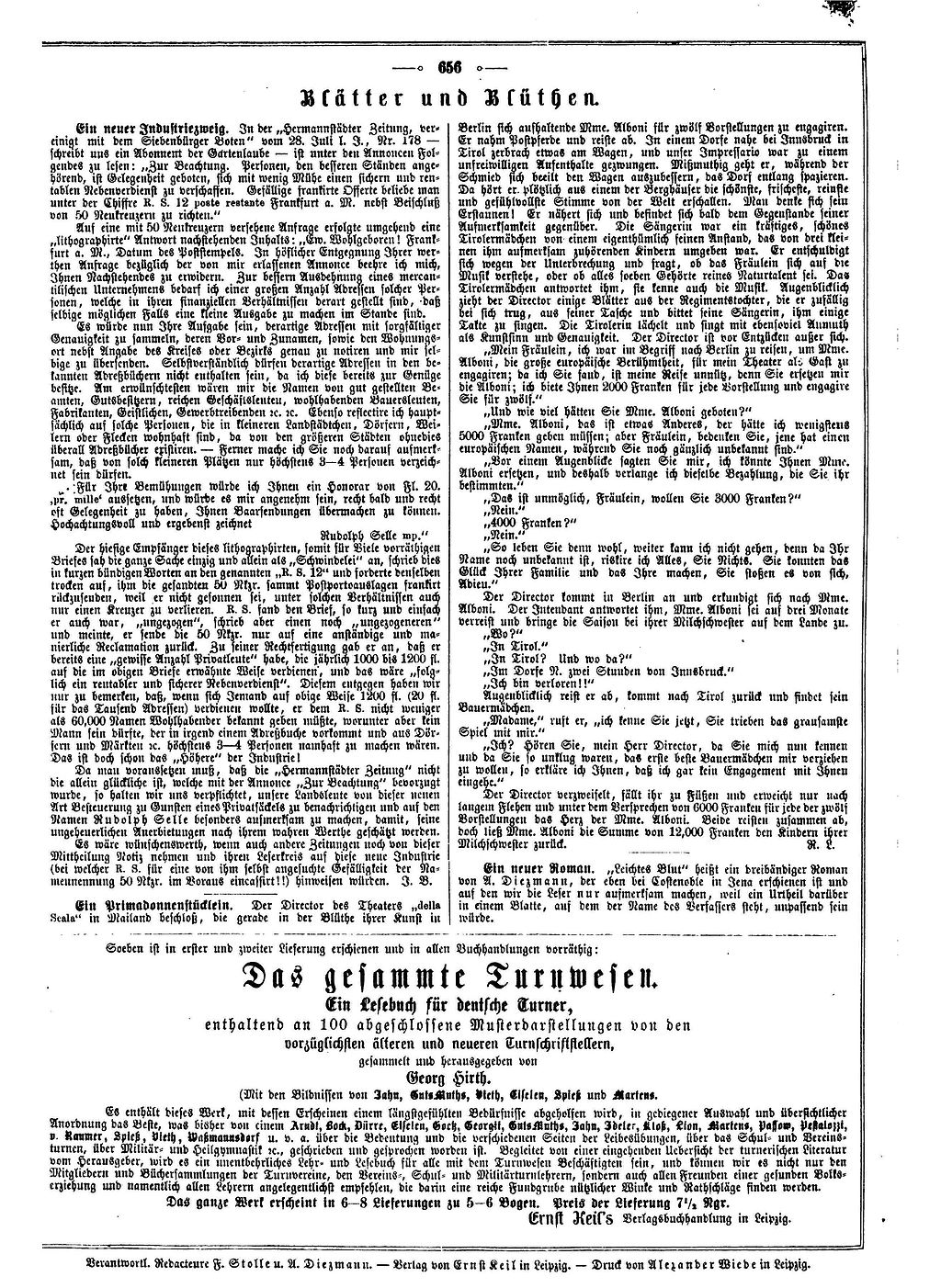| verschiedene: Die Gartenlaube (1864) | |
|
|
Ein neuer Industriezweig. In der „Hermannstädter Zeitung, vereinigt mit dem Siebenbürger Boten“ vom 28. Juli l. J., Nr. 178 – schreibt uns ein Abonnent der Gartenlaube – ist unter den Annoncen Folgendes zu lesen: „Zur Beachtung. Personen, den besseren Ständen angehörend, ist Gelegenheit geboten, sich mit wenig Mühe einen sichern und rentablen Nebenverdienst zu verschaffen. Gefällige frankirte Offerte beliebe man unter der Chiffre R. S. 12 poste restante Frankfurt a. M. nebst Beischluß von 50 Neukreuzern zu richten.“
Auf eine mit 50 Neukreuzern versehene Anfrage erfolgte umgehend eine „lithographirte“ Antwort nachstehenden Inhalts: „Ew. Wohlgeboren! Frankfurt a. M., Datum des Poststempels. In höflicher Entgegnung Ihrer werthen Anfrage bezüglich der von mir erlassenen Annonce beehre ich mich, Ihnen Nachstehendes zu erwidern. Zur bessern Ausdehnung eines mercantilischen Unternehmens bedarf ich einer großen Anzahl Adressen solcher Personen, welche in ihren finanziellen Verhältnissen derart gestellt sind, daß selbige möglichen Falls eine kleine Ausgabe zu machen im Stande sind.
Es würde nun Ihre Aufgabe sein, derartige Adressen mit sorgfältiger Genauigkeit zu sammeln, deren Vor- und Zunamen, sowie den Wohnungsort nebst Angabe des Kreises oder Bezirks genau zu notiren und mir selbige zu übersenden. Selbstverständlich dürfen derartige Adressen in den bekannten Adreßbüchern nicht enthalten sein, da ich diese bereits zur Genüge besitze. Am erwünschtesten wären mir die Namen von gut gestellten Beamten, Gutsbesitzern, reichen Geschäftsleuten, wohlhabenden Bauersleuten, Fabrikanten, Geistlichen, Gewerbtreibenden etc. ic. Ebenso reflectire ich hauptsächlich auf solche Personen, die in kleineren Landstädtchen, Dörfern, Weilern oder Flecken wohnhaft sind, da von den größeren Städten ohnedies überall Adreßbücher existiren. – Ferner mache ich Sie noch darauf aufmerksam, daß von solch kleineren Plätzen nur höchstens 3–4 Personen verzeichnet sein dürfen.
Für Ihre Bemühungen würde ich Ihnen ein Honorar von Fl. 20. pr. mille aussetzen, und würde es mir angenehm sein, recht bald und recht oft Gelegenheit zu haben, Ihnen Baarsendungen übermachen zu können.
Hochachtungsvoll und ergebenst zeichnet
Der hiesige Empfänger dieses lithographirten, somit für Viele vorräthigen Briefes sah die ganze Sache einzig und allein als „Schwindelei“ an, schrieb dies in kurzen bündigen Worten an den genannten R. S. 12“ und forderte denselben trocken auf, ihm die gesandten 50 Nkzr. sammt Postportoauslagen frankirt rückzusenden, weil er nicht gesonnen sei, unter solchen Verhältnissen auch nur einen Kreuzer zu verlieren. R S. fand den Brief, so kurz und einfach er auch war, „ungezogen“, schrieb aber einen noch „ungezogeneren“ und meinte, er sende die 50 Nkzr. nur auf eine anständige und manierliche Reclamation zurück. Zu seiner Rechtfertigung gab er an, daß er bereits eine „gewisse Anzahl Privatleute“ habe, die jährlich 1000 bis 1200 fl. auf die im obigen Briefe erwähnte Weise verdienen, und das wäre „folglich ein rentabler und sicherer Nebenverdienst“. Diesem entgegen haben wir nur zu bemerken, daß, wenn sich Jemand auf obige Weise 1200 fl. (20 fl. für das Tausend Adressen) verdienen wollte, er dem R. S. nicht weniger als 60,000 Namen Wohlhabender bekannt geben müßte, worunter aber kein Mann sein dürfte, der in irgend einem Adreßbuche vorkommt und aus Dörfern und Märkten etc. höchstens 3–4 Personen namhaft zu machen wären. Das ist doch schon das „Höhere“ der Industrie!
Da man voraussetzen muß, daß die „Hermannstädter Zeitung“ nicht die allein glückliche ist, welche mit der Annonce „Zur Beachtung“ bevorzugt wurde, so halten wir uns verpflichtet, unsere Landsleute von dieser neuen Art Besteuerung zu Gunsten eines Privatsäckels zu benachrichtigen und auf den Namen Rudolph Selle besonders aufmerksam zu machen, damit, seine ungeheuerlichen Anerbietungen nach ihrem wahren Werthe geschätzt werden.
Es wäre wünschenswerth, wenn auch andere Zeitungen noch von dieser Mittheilung Notiz nehmen und ihren Leserkreis auf diese neue Industrie (bei welcher R. S. für eine von ihm selbst angesuchte Gefälligkeit der Namennennung 50 Nkzr. im Voraus eincassirt!!) hinweisen würden.
Ein Primadonnenstücklein. Der Director des Theaters „della Scala“ in Mailand beschloß, die gerade in der Blüthe ihrer Kunst in Berlin sich aufhaltende Mme. Alboni für zwölf Vorstellungen zu engagiren. Er nahm Postpferde und reiste ab. In einem Dorfe nahe bei Innsbruck in Tirol zerbrach etwas am Wagen, und unser Impressario war zu einem unfreiwilligen Aufenthalte gezwungen. Mißmuthig geht er, während der Schmied sich beeilt den Wagen auszubessern, das Dorf entlang spazieren. Da hört er plötzlich aus einem der Berghäuser die schönste, frischeste, reinste und gefühlvollste Stimme von der Welt erschallen. Man denke sich sein Erstaunen! Er nähert sich und befindet sich bald dem Gegenstande seiner Aufmerksamkeit gegenüber. Die Sängerin war ein kräftiges, schönes Tirolermädchen von einem eigenthümlich feinen Anstand, das von drei kleinen ihm aufmerksam zuhörenden Kindern umgeben war. Er entschuldigt sich wegen der Unterbrechung und fragt, ob das Fräulein sich auf die Musik verstehe, oder ob alles soeben Gehörte reines Naturtalent sei. Das Tirolermädchen antwortet ihm, sie kenne auch die Musik. Augenblicklich zieht der Director einige Blätter aus der Regimentstochter, die er zufällig bei sich trug, aus seiner Tasche und bittet seine Sängerin, ihm einige Takte zu singen. Die Tirolerin lächelt und singt mit ebensoviel Anmuth als Kunstsinn und Genauigkeit. Der Director ist vor Entzücken außer sich.
„Mein Fräulein, ich war im Begriff nach Berlin zu reisen, um Mme. Alboni, die große europäische Berühmtheit, für mein Theater als Gast zu engagiren; da ich Sie fand, ist meine Reise unnütz, denn Sie ersetzen mir die Alboni; ich biete Ihnen 2000 Franken für jede Vorstellung und engagire Sie für zwölf.“
„Und wie viel hätten Sie Mme. Alboni geboten?“
„Mme. Alboni, das ist etwas Anderes, der hätte ich wenigstens 5000 Franken geben müssen; aber Fräulein, bedenken Sie, jene hat einen europäischen Namen, während Sie noch gänzlich unbekannt sind.“
„Vor einem Augenblicke sagten Sie mir, ich könnte Ihnen Mme. Alboni ersetzen, und deshalb verlange ich dieselbe Bezahlung, die Sie ihr bestimmten.“
„Das ist unmöglich, Fräulein, wollen Sie 3000 Franken?“
„Nein.“
„4000 Franken?“
„Nein.“
„So leben Sie denn wohl, weiter kann ich nicht gehen, denn da Ihr Name noch unbekannt ist, riskire ich Alles, Sie Nichts. Sie konnten das Glück Ihrer Familie und das Ihre machen, Sie stoßen es von sich, Adieu.“
Der Director kommt in Berlin an und erkundigt sich nach Mme. Alboni. Der Intendant antwortet ihm, Mme. Alboni sei auf drei Monate verreist und bringe die Saison bei ihrer Milchschwester auf dem Lande zu.
„Wo?“
„In Tirol.“
„In Tirol? Und wo da?“
„Im Dorfe N. zwei Stunden von Innsbruck.“
„Ich bin verloren!!“
Augenblicklich reist er ab, kommt nach Tirol zurück und findet sein Bauernmädchen.
„Madame,“ ruft er, „ich kenne Sie jetzt, Sie trieben das grausamste Spiel mit mir.“
„Ich? Hören Sie, mein Herr Director, da Sie mich nun kennen und da Sie so unklug waren, das erste beste Bauermädchen mir verziehen zu wollen, so erkläre ich Ihnen, daß ich gar kein Engagement mit Ihnen eingehe.“
Der Director verzweifelt, fällt ihr zu Füßen und erweicht nur nach langem Flehen und unter dem Versprechen von 6000 Franken für jede der zwölf Vorstellungen das Herz der Mme. Alboni. Beide reisten zusammen ab, doch ließ Mme. Alboni die Summe von 12,000 Franken den Kindern ihrer Milchschwester zurück.
Ein neuer Roman. „Leichtes Blut“ heißt ein dreibändiger Roman von A. Diezmann, der eben bei Costenoble in Jena erschienen ist und auf den wir die Leser nur aufmerksam machen, weil ein Urtheil darüber in einem Blatte, auf dem der Name des Verfassers steht, unpassend sein würde.
Soeben ist in erster und zweiter Lieferung erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:
vorzüglichsten älteren und neueren Turnschriftstellern,
gesammelt und herausgegeben von
Georg Hirth.
(mit den Bildnissen von Jahn, GutsMuths, Vieth, Eiselen, Spieß und Martens.
Es enthält dieses Werk, mit dessen Erscheinen einem längstgefühlten Bedürfnisse abgeholfen wird, in gediegener Auswahl und übersichtlicher Anordnung das Beste, was bisher von einem Arndt, Bock, Dürre, Eiselen, Gock, Georgii, GutsMuths, Jahn, Ideler, Kloß, Lion, Martens, Passow, Pestalozzi, v. Raumer, Spieß, Vieth, Waßmannsdorf u. v. a. über die Bedeutung und die verschiedenen Seiten der Leibesübungen, über das Schul- und Vereinsturnen, über Militär- und Heilgymnastik etc., geschrieben und gesprochen worden ist. Begleitet von einer eingehenden Uebersicht der turnerischen Literatur vom Herausgeber, wird es ein unentbehrliches Lehr- und Lesebuch für alle mit dem Turnwesen Beschäftigten sein, und können wir es nicht nur den Mitgliedern und Büchersammlungen der Turnvereine, den Vereins-, Schul- und Militärturnlehrern, sondern auch allen Freunden einer gesunden Volkserziehung und namentlich allen Lehrern angelegentlichst empfehlen, die darin eine reiche Fundgrube nützlicher Winke und Rathschläge finden werden.
verschiedene: Die Gartenlaube (1864). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1864, Seite 656. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1864)_656.jpg&oldid=- (Version vom 14.9.2022)